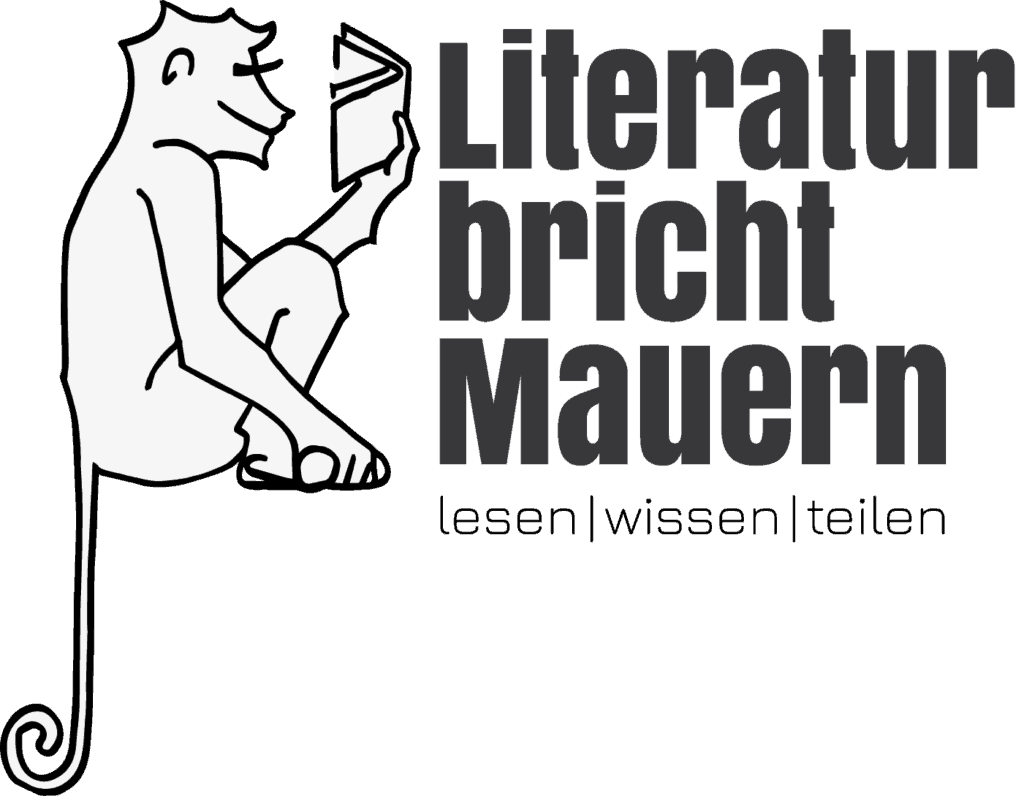Bücher gegen „Mauern im Kopf“
„Seit frühester Jugend sind wir Menschen daran gewöhnt, verfälschte Berichte zu hören, und seit Jahrhunderten ist unser Geist von Vorurteilen derartig durchtränkt, dass er phantastische Lügen wie einen Schatz hütet und uns Wahrheiten als unglaubwürdig, Fälschungen dagegen als wahr erscheinen.“
Dieser Satz stammt von Sanchuniathon; der phönizische Geschichtsschreiber formulierte ihn vor zirka 3.250 Jahren – also noch vor dem Trojanischen Krieg. Ob er seine Erkenntnis als kritische Analyse verstand oder als Anleitung zur Manipulation ist unklar. Uns überliefert ist seine Feststellung lediglich aus der Übersetzung ins Griechische von Herennios Philon (um 70 bis 138 christlicher Zeitrechnung).
Zur Verteidigung, auch zum Schutz der eigenen Kultur, ließen die Kaiser Chinas die Lange Chinesische Mauer errichten. Der Hadrianswall bzw. Limes waren Grenzanlagen des römischen Weltreiches zur Kontrolle des alltäglichen Waren- und Personenverkehrs. Die Reservate für amerikanische Ureinwohner, die Apartheid in Südafrika wie die in Namibia, kombinierten Ausgrenzung mit kolonialer Ausbeutung. Die innerdeutsche Grenzanlage und die Berliner Mauer waren und das Bollwerk zwischen Nord- und Südkorea ist manifestierte Systemtrennung mit Verhinderung ziviler Migration – wie der Grenzzaun bei Ceuta, die angekündigte Mauer der USA zu Mexiko und, und, und …
Allein der Vollständigkeit halber: Nicht gemeint sind die Wände zum Schutz vor Wind und Wetter oder jene zur Sicherung von Menschlichkeit, die Umfriedungen der Besinnlichkeit, der Intimität – und auch nicht die Westliche Mauer in der Altstadt von Jerusalem.
Bei „Literatur bricht Mauern“ geht es um die unsichtbaren Barrieren zwischen Gruppen, Gesellschaften, Religionen, zwischen Mehr-
und Minderheiten, den Generationen – um projizierte Mauern zwischen den Menschen, um Exklusion: den Ausschluss aufgrund von Äußerlichkeit, Geschlecht, Herkunft, Identität, zivilisatorischer Tradition, gesundheitlicher Kondition und inzwischen wieder auch Genetik. Zudem geht es um die Mauern der Geschichte: zwischen der Vergangenheit und unserer Gegenwart und die vor ungewisser Zukunft. Sie mögen ebenso trennend wirken.
Das klingt vielleicht banal, sind es bloß Mauern im Kopf. Doch „intelligentes“ Schwarmverhalten mag keine Begründung für Abgrenzung bieten – wohl eher das kollektiv Unbewusste mit seiner tatsächlich hilfreichen Vorab-Bewertung allem Unbekannten – aber auch mit den von jedem Sinn entleerten Verallgemeinerungen.
Aufklärung und Bildung, dazu Ethik und Empathie, brechen solche Mauern auf. Und gemäß unserem Wissen darüber zu handeln, sensibel dennoch konkret, das will „Literatur bricht Mauern“ und empfiehlt Bücher, die geeignet sind, die Mauern im Kopf aufzubrechen.